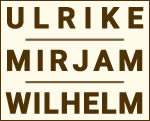Zusammenfassung des Buches:
Der Erzählband Auf Abwegen (168 Seiten) von Kamiab Falaki umfasst 20 Geschichten, Kurzgeschichten und längere Erzählungen, einige Gedichte und Bilder des Autors.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Risse und Unerwartet. Im ersten Teil begegnen wir Migrant*innen, vor allem aus dem Iran.
Der Teil Unerwartet mit deutschen Protagonisten umfasst Einzelgeschichten, in jeder von ihnen gibt es eine vollkommen unerwartete Wendung.
So verschieden die Sozialisation, die Charaktere, die Milieus auch sind, die Protagonisten in beiden Teilen durchlaufen ähnliche innere Prozesse: Verlust und Sehnsucht, Schuld, Scham, Scheitern und Angst. Auch zeitlose universale Themen wie Freier Wille, Diktatur der Erinnerung, Machtverhältnisse, Verrat und Rache werden durchleuchtet. Aber auch Menschlichkeit, Freundschaft, ekstatische Momente und Sinnlichkeit.
Alle Geschichten entwickeln sich um einen zentralen Plot herum und sind so angelegt, dass der Leser mögliche Fortsetzungen weiterspinnen kann. Einige Texte vom ersten Teil sind autobiografisch gefärbt.
In einigen Geschichten im zweiten Teil fließt die brandaktuelle politische und gesellschaftliche Realität in Deutschland und Aspekte der sozialen Misere ein.
Die Perspektive ist mal die des Ich-Erzählers, mal die der dritten Person.
Zwei Geschichten sind vorwiegend in Dialogen an gelegt, Psychoduelle, in denen die Worte Mimik und Gesten ersetzen.
Die Handlungen zeichnen spannende Begegnungen mit pointierten Dialogen und eine beeindruckende bildhafte Sprache aus. In eindringlichen Szenerien entwickeln sich oft atmosphärisch dichte Dramen fern von Pathos, ohne moralische Zeigefinger und aufgesetzte Empörung.
Verschiedene Settings und abwechslungsreiche Figurenensembles über die Landesgrenzen hinweg vermitteln Geschichten von entwurzelten Menschen, die dies- und jenseits der geografischen Grenzen außerhalb der sogenannten Normalität geraten sind.
Der Autor erzählt mit Sympathie für und mit Respekt gegenüber seinen Figuren. Die Lektüre dieses Buches hinterlässt mit ihrer abwechslungsreichen und thematischen Tiefe einen aufwühlenden und nachhaltigen Eindruck.